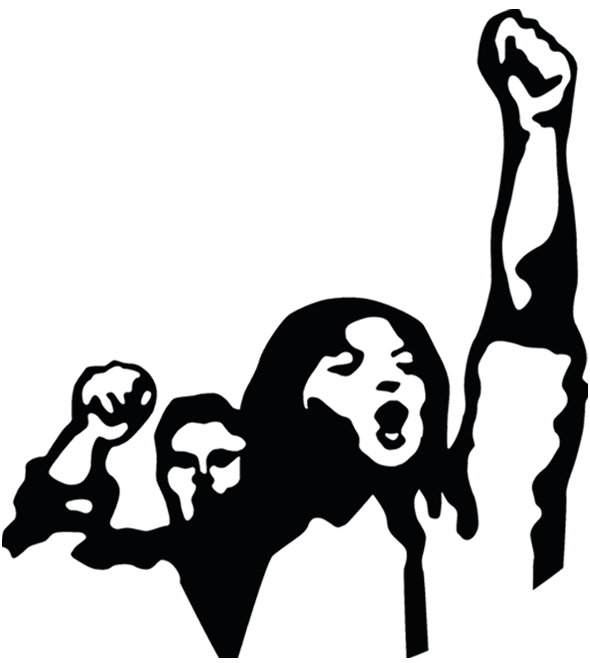ausspähen statt aufklären: gegen die ausweitung der quellen-tkü
30.11.2020
Der Messerangriff auf ein schwules Paar in Dresden, der Mord an Samuel Paty in einem Pariser Vorort und der Anschlag auf Menschen in einer Kirche in Nizza: Islamistischer Terror rückt wieder einmal in das Bewusstsein der Politik. Und das vollkommen zurecht, da es sich um eine mörderische Ideologie handelt, die jede Form von Freiheit und Selbstbestimmung vernichten will.
Das Problem ist dabei nur: Viele Forderungen dieser Tage sägen am gleichen Stuhl. Als Konsequenz aus den Morden bekommen viele Konservative einmal mehr Schnappatmung und blasen diese in das gleiche Horn: Nachrichten mitlesen, Chatdienste entschlüsseln, „das Internet überwachen!!!“.
So absurd es auch klingt (das letzte ist übrigens ein O-Ton Horst Seehofers), genau das ist es, was deutsche Politik als notwendig ansieht, um den Terror religiöser Fanatiker zu besiegen. Nicht etwa mehr Geld für Programme wie „Demokratie Leben“ auszugeben, das Projekte gegen Menschenfeindlichkeit fördert. Nein, hier war schon letztes Jahr geplant, Gelder anders zu verteilen und zu kürzen. Dazwischen kamen leider nur die rechtsextremistischen Anschläge von Halle und Hanau. Ups.
Ebenso wenig wird über den Aufbau von säkularen Islamverbänden mit Bundesmitteln nachgedacht, die sich klar gegen islamistische Strömungen stellen. Dabei wird in deutschen Moscheen und insbesondere in Hamburg teils offen für die Scharia geworben, ohne dass Islamverbände wie die Schura Konsequenzen für ihr Handeln tragen müssen.
Das sinnvollste Mittel in den Augen der Handelnden scheint es dann doch zu sein, sich an der Überwachung der breiten Bevölkerung zu üben. So will die Bundesregierung zukünftig auch den Geheimdiensten erlauben, Kommunikation über WhatsApp und andere verschlüsselte Messenger-Dienste, wie Telegram oder Signal, mitzulesen. Namentlich sollen der Verfassungsschutz, der Bundesnachrichtendienst und der Militärische Abschirmdienst (MAD) die sogenannte Quellen-Telekommunikationsüberwachung (Quellen-TKÜ) einsetzen dürfen.
Einfach gesagt funktioniert das Ganze, indem ein „Staatstrojaner“ auf einem Laptop oder auf ein Telefon aufgespielt wird. Damit können dann Nachrichten mitgelesen werden, und zwar bevor sie verschlüsselt werden. Dies hebelt das System der „Ende-zu-Ende“-Verschlüsselung aus, welches die meisten Chatdienste verwenden.
Die Polizei kann genau das schon seit 2017 über Paragraf 100a der Strafprozessordnung (StPO) tun. Gedacht ist dies für Ermittlungen zu schweren Straftaten wie Terrorismus und Mord, aber auch der Verdacht auf Geldwäsche und Rauschgifthandel reichen dafür aus. Wenn schon der Handel von Drogen mit dem Mord an mehreren Menschen gleichgesetzt wird, wo besteht dann eine sinnvolle Abgrenzung zu der Überwachung von, beispielsweise, „illegalen“ spontanen Versammlungen oder dem Malen von „ACAB“-Plakaten?
Der Schutz, den die Gesetzgebenden jetzt einbauen möchten, ist äußerst gering. Die Anwendung der Quellen-TKÜ für Geheimdienste soll, nicht wie in Paragraf 100a, schon nach richterlicher Anordnung erfolgen, sondern erst nach einer Genehmigung durch die G10-Kommission im Bundestag. Da diese jedoch meistens aus Politiker*innen besteht, die kaum eine komplett andere Meinung als ihre Partei vertreten, darf davon ausgegangen werden, dass die Hürden für eine Überwachung nicht sonderlich hoch liegen.
Dass die Polizei ihre Befugnisse in diesem Bereich bisher wohl wenig bis gar nicht verwendet hat, stellt dabei nur einen schwachen Trost dar. Die digitale Inkompetenz deutscher Behörden wird (leider) nicht von ewiger Dauer sein und so ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der Paragraf auch für Kavaliersdelikte zum Einsatz kommen kann.
Die Tendenz, Grenzen zwischen der Polizei und den Sicherheitsbehörden zu verwischen, ist dabei nicht neu. Dies lässt sich im neuen Bayerischen Polizeigesetz aus 2018 erkennen, in dem die Polizei Überwachungsmaßnahmen schon bei „drohender Gefahr“, also bereits vor der eigentlichen Eingriffsschwelle, einsetzen darf. Das in der Verfassung verankerte Trennungsprinzip zwischen Polizei und Nachrichtendiensten wurde hier nach zwei Paulaner Hefeweizen kurzerhand einfach vergessen. Mei, sei’s drum.
Seit langem dürfen Sicherheitsbehörden, um Staatstrojaner einzuschleusen, auch Lücken in Soft- und Hardware ausnutzen, von denen noch nicht einmal die Hersteller etwas wissen. Dass solche Lücken nicht nur zum Hacken durch Behörden, sondern auch von Kriminellen ausgenutzt werden können, kommt scheinbar niemandem in den Sinn. Eine Institution, deren eigene IT-Systeme bereits mehrfach gehackt wurden, stimmt nun also für die Einrichtung eines Trojaners gegen die Bevölkerung. Die Cybersicherheit der ganzen Gesellschaft scheint weniger wert zu sein, als das unbedingte Bedürfnis, endlich grenzenlosen Zugang zu Tinder-Chats und Politikgruppen zu gewinnen.
Wessen Geistes Kind das neue Gesetz ist, zeigt sich auch beim Blick auf vorherige Versuche, das Vorhaben durchzupeitschen. Im ersten Entwurf aus dem März 2019 war von sogenannten Online-Durchsuchungen die Rede. Bei dieser Maßnahme kann ein Computersystem umfassend durchsucht werden. Dabei können nicht nur Kommunikationsdaten, sondern alle in der Vergangenheit gespeicherten Daten gesichtet werden. Somit hätten die Ermittelnden Zugang zu längst vergangenen Chatverläufen, Fotos, Notizen oder Browserverläufen.
War die SPD als Koalitionspartnerin hier noch klar dagegen, ist sie jetzt wieder einmal eingeknickt. Digitale Rechte aller Bürger*innen zum Abschuss freizugeben scheint dabei der nötige Einsatz zu sein, um damit eine Studie durchzubringen, die das Papier, auf dem sie steht, nicht wert ist. Eine Studie, in der Rassismus innerhalb der Polizei zusammen mit sogenannten Hasstaten gegen die Polizei ermittelt werden soll. In etwa so als würde man herausfinden wollen, wer die meisten Gegentore beim HSV verschuldet und dafür alle gelben Karten von Aue und Paderborn analysiert. Mit anderen Worten: Zwei paar Schuhe, die nichts miteinander zu tun haben und dem eigentlichen Problem nicht einmal ansatzweise gerecht werden.
Neben bundesweiten Geheimdiensten dürfen auch alle 16 Landesämter für Verfassungsschutz Endgeräte hacken, um Kommunikation auszuleuchten. Das gibt den Landesämtern die Freiheit, alle ihrer Beobachtungsfälle auszuspionieren. Dazu gehören in Bayern zum Beispiel der Verein der Verfolgten des Naziregimes oder in Berlin Ende Gelände.
Der Entwurf sieht auch einen erweiterten Austausch von Informationen zwischen dem MAD und den Verfassungsschutzbehörden vor. Zudem werden die Hürden für die Beobachtung von Einzelpersonen durch den Verfassungsschutz gesenkt. Well Done, GroKo! Es ergibt natürlich absolut Sinn, den Austausch zwischen genau den beiden Behörden zu verbessern, die einerseits Informationen an Nazis innerhalb der Bundeswehr weitergegeben haben und andererseits von NSU bis Anis Amri in diverse Terroranschläge verstrickt waren. Vielleicht klappt dann beim nächsten Mal wenigstens die Vertuschung etwas besser. Auf den Gedanken zu kommen, dass man die Helfershelfenden von Terrorist*innen nicht loswird, indem man ihnen mehr Kompetenzen zuspricht, scheint wohl zu viel verlangt zu sein.
So weit so gut, da wandere ich doch lieber nach Italien aus, mag sich der ein oder die andere denken. Besseres Klima und an der Adriaküste ungestört mit meinen Liebsten schreiben. Schön wär‘s. Denn nun springt auch der EU-Ministerrat auf den Überwachungszug auf und bereitet eine Resolution vor, die ebenso fordert, Polizei und anderen „autorisierten Behörden“ den Zugriff auf verschlüsselte Kommunikation zu erlauben.
Diese sollen dadurch in legitimen Fällen der organisierten oder schweren Kriminalität oder der Terrorismusbekämpfung „rechtmäßig auf relevante Daten zugreifen können“. Solche Hintertüren würden genau das verhindern, was sie vorgeben zu wollen, nämlich: effektive Terrorismusbekämpfung. Auch wenn dies nur von der Kommission beschlossen werden kann und damit noch nicht feststeht, ist die Tendenz klar: Heimat-Horst weckt den Schnüffelgeist auch in Europa.
Die Konsequenz aus Halle, Hanau oder Dresden kann nicht lauten, die gesamte Bevölkerung zu durchleuchten, sondern vorhandene Instrumente gezielt gegen Terrorist*innen anzuwenden und vor allem den eigenen Sumpf aus rechtsextremen und terrornahen Strukturen endlich trockenzulegen. Das jahrelange Morden des NSU, trotz des Ausbaus von Überwachungsmaßnahmen, hat dies mehr als deutlich aufgezeigt. Von einem Innenminister, der selbst nur mit Mühe Spiegel Online auf seinem Smartphone bedienen kann, kann man für solche Fakten allerdings natürlich kein Verständnis erwarten.